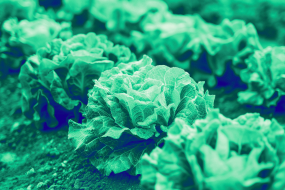Farming

Gremien zum Thema Farming
Unsere Mitglieder haben die Möglichkeit, die Arbeit des Bitkom in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Unsere Gremien sind zudem eine Plattform, um sich mit Wettbewerbern, Partnern und Kunden zu vernetzen.