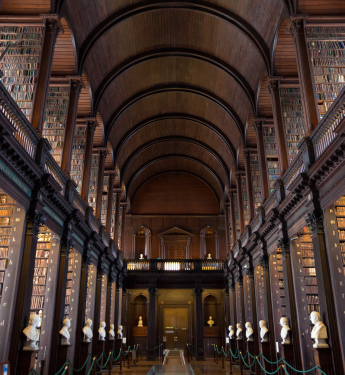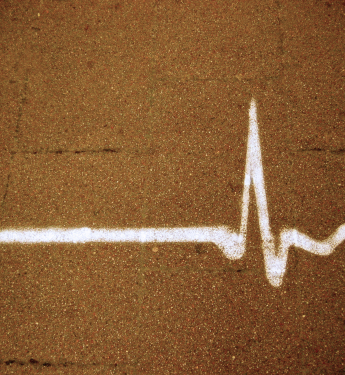Digitale Gesellschaft – Digitalstrategie 2025
Digitales Deutschland 2025
Digitale Gesellschaft
Die Auswirkungen der Digitalisierung berühren alle unserer Lebensphasen: Das beginnt bei der Aus- und Weiterbildung, erstreckt sich über Wissenschaft und Forschung und endet nicht bei unseren Berufen und Arbeitsbedingungen. Wichtig ist: Es braucht begründeten Optimismus durch positive eigene Erfahrungen statt diffuser Angst vor dem Neuen. Das gelingt nur durch einen souveränen, aufgeklärten Umgang mit Möglichkeiten und Risiken der Digitalisierung. Der Bitkom wird deshalb gemeinsam mit einem breiten gesellschaftlichen Bündnis seinen Beitrag leisten und einen bundesweiten Digitaltag ins Leben rufen. Auf Seiten der Politik muss der Anspruch sein, dass alle Menschen am Wohlstandstreiber Digitalisierung teilhaben können – in der Stadt oder auf dem Land, unabhängig von Status, Herkunft oder Alter. Dafür braucht es entsprechende politische Rahmenbedingungen.
Handlungsempfehlungen
- Schulen zu Smart Schools ausbauen: Alle Schulen sollen im digitalen Zeitalter ankommen. Grundvoraussetzungen dafür sind eine leistungsfähige digitale Infrastruktur, die Vermittlung von digitalen Kompetenzen für Lehrkräfte in Aus- und Fortbildungen sowie die fächerübergreifende curriculare Verankerung digitaler Inhalte und Technologien.
- Digitalpakt zügig umsetzen und zweiten Digitalpakt anstoßen: Der von Bund und Ländern verabschiedete Digitalpakt muss zügig in den Schulen ankommen: Bis Ende 2020 sollte jede Schule von Digitalpaktmitteln profitiert haben. Die vorgesehenen 5 Mrd. € sind ein erster Schritt, reichen aber nicht aus. Der Bund muss eine leistungsfähige digitale Infrastruktur und Lehrerfortbildungen über den Digitalpakt hinaus langfristig finanziell absichern. Für jeden Euro, der in die Infrastruktur fließt, muss auch ein Euro in die Weiterbildung der Lehrer sowie in die Wartung der IT fließen.
- Kooperationsverbot in der Bildung abschaffen: Die Bildungspläne der Länder müssen für die Digitalisierung fit gemacht werden. Dafür bedarf es auch bundesweit einheitlicher Bildungsstandards, auf die sich die Länder verständigen müssen.
- Berufliche Bildung stärken: Das Image der dualen Ausbildung muss verbessert und die Gleichwertigkeit mit der akademischen Ausbildung betont werden. Mit BMBF-Mitteln sollte ein Forschungsinstitut „Berufe mit Zukunft“ aufgebaut werden, das die Perspektiven von Berufsbildern und Kompetenzprofilen untersuchen und dessen Ergebnisse direkt in die Berufsberatung und Bildungspolitik einfließen.
- Weiterbildung digital und flexibel gestalten: Damit die heutigen Beschäftigten an der digitalen Transformation optimal teilhaben können, müssen flexiblere und individuellere Wege digitaler Weiterbildung geschaffen werden. Dafür braucht es steuerliche Anreize für Unternehmen und Arbeitnehmer. Die nationale Weiterbildungsstrategie sollte zügig umgesetzt und als Anlass genutzt werden, eine Weiterbildungskultur zu etablieren, die Transparenz und Nutzerorientierung in den Mittelpunkt stellt.
-
Hochschulbildung zeitgemäß und attraktiv gestalten: Damit die Lehrkräfte von morgen ihren Unterricht zeitgemäß gestalten können, muss digitale Bildung fester Bestandteil des Lehramtsstudiums werden. Darüber hinaus muss Deutschlands IT-Fachkräftenachwuchs gesichert werden. Durch eine bessere Ausstattung der Hochschulen, mehr Professuren sowie eine zeitgemäße Lehre kann der hohen Abbruchquote in Informatikstudiengängen begegnet werden – und wir können mehr junge Menschen für das Fach begeistern.
Handlungsempfehlungen
- Reallabore etablieren: Reallabore bieten die Möglichkeit, Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in die ökonomische Anwendung zu diffundieren. Sowohl Startups und Gründungen aus der Forschung als auch die Validierung des Innovationspotenzials von Forschungsergebnissen werden somit gefördert. Für den Erfolg sind allerdings echte Freiräume und zügige regulatorische Anpassungen nach erfolgreichen Experimenten essentiell.
- Ausgründungen fördern: Der effiziente Wissens- und Technologietransfer von der Forschung in die Wirtschaft ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Die kommerzielle Verwertung von Wissen über Ausgründungen in High-Tech-Sektoren spielt hierbei eine wichtige Rolle. Es gilt daher, die Rahmenbedingungen hierfür zu verbessern. Hochschulen sollten darüber hinaus weiterhin Gründungs- und Innovationszentren betreiben sowie Urlaubssemester für Gründungen zulassen.
- Ökosysteme ausbauen: Ökosysteme bieten ein fruchtbares Umfeld aus etablierten Konzernen, Startups, Universitäten und Forschungszentren. Es gilt, ähnliche Ökosysteme, wie z.B. die Digital Hubs, weiter zu stärken.
- Fokus auf Innovationen setzen: Ziel der Projektförderung ist es, Innovationen in den Markt zu bringen – dies können nur Unternehmen. Im Sinne einer erfolgreichen Innovationspolitik müssen die Forschungsfördermittel für die Wirtschaft verdoppelt werden.
Handlungsempfehlungen
- Digitale Angebote ermöglichen: Digitale Infrastrukturen, im Festnetz, wie im Mobilfunknetz, bilden das Rückgrat von Teilhabe in der digitalen Gesellschaft. Es müssen daher Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Ausbau in Stadt und Land wirtschaftlich ermöglichen und weiter beschleunigen. Nur dann werden digitale Angebote zum Beispiel in den Bereichen Mobilität und Gesundheit auch im ländlichen Raum verfügbar sein.
- Barrierefreiheit gewährleisten: Der barrierefreie Zugang zu Produkten und Dienstleistungen insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik ist eine Grundvoraussetzung für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Gesellschaft und Beruf. Digitale Anwendungen sollten daher auf Barrierefreiheit überprüft werden und ggf. auf Grundlage der „Accessible Design"- bzw. „Design for All“-Prinzipien angepasst werden.
- Digitale Inklusion fördern: Teil einer Digitalstrategie der Bundesregierung müssen Überlegungen sein, wie alle Menschen an den Vorteilen der Digitalisierung partizipieren können. Dazu gehört, vor allem jene Bevölkerungsgruppen in eine solche Strategie einzubeziehen, die bisher signifikant weniger mit digitalen Technologien in Berührung kommen.
- Ehrenamt digital unterstützen: Bürger leisten mit ihrem Engagement, u.a. in Vereinen, Kirchen und Parteien, einen entscheidenden Beitrag für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Dieses Engagement gilt es mit digitalen Technologien zu unterstützen und beispielsweise durch eine „digitale Ehrenamtskarte“ zu würdigen.
- Digitaltag einführen: Neben der Aufstellung von Forderungen leisten wir auch selbst einen Beitrag: Gemeinsam mit dem breiten gesellschaftlichen Bündnis „Digital für alle“ planen wir einen bundesweiten Aktionstag, um Digitalisierung überall erfahrbar zu machen. Eine intensive Mitwirkung von Bund, Ländern und den Verwaltungen vor Ort würde dieses Projekt stärken.
Handlungsempfehlungen
- Maximales privatwirtschaftliches Engagement generieren: Es muss so viel privatwirtschaftliches Engagement wie möglich generiert und inzentiviert werden. Gleichzeitig muss die Entwertung bereits getätigter Investitionen verhindert werden. Die Umsetzung des Europäischen Kodex für elektronische Kommunikation setzt den Rahmen für die Entwicklung des Telekommunikationssektors der nächsten Dekade. Sie bietet die Chance, die Digitalisierung und Vernetzung Deutschlands zu gestalten und zu beschleunigen.
- Öffentliche Fördermittel bereitstellen: Die staatliche finanzielle Förderung des Netzausbaus muss weiterhin das letzte Mittel bleiben und darf den eigenfinanzierten Ausbau der Unternehmen nicht verdrängen, verzerren oder gar entwerten. Um flächendeckend schnelle Internetverbindungen im ländlichen Raum sicherzustellen, ist die öffentliche Hand aber dort gefragt, wo ein wirtschaftlicher Ausbau perspektivisch nicht machbar ist. Für diese unterversorgten Gebiete braucht es unter Berücksichtigung eines ausreichenden Investitionsschutzes auch künftig öffentliche Mittel zur Förderung des Ausbaus von Glasfasernetzen. Hierbei müssen auch weiterhin Anbindungsbedarfe für bestehende oder künftige Mobilfunkstandorte in die Glasfasernetzplanungen einbezogen werden.
- Mobilfunk stärken: 5G ist eine zentrale Technologie der Gigabit-Gesellschaft. Für den Auf- und Ausbau der entsprechenden Infrastruktur ist eine vorausschauende und europaweit koordinierte Frequenzstrategie, inklusive der Zuweisung weiterer Frequenzen für Mobilfunk, nötig. Zusätzlich ist auch für WLAN weiteres Spektrum erforderlich. Die zukünftige Ausrichtung der Frequenzregulierung muss mehr Rechts- und Planungssicherheit schaffen, um die Bedingungen des Mobilfunkausbaus zu verbessern. Eine etwaige Förderung von Mobilfunkstandorten muss wettbewerbsneutral erfolgen, um letzte verbleibende weiße Flecken zu schließen und den Roll-Out von 5G zu beschleunigen.
- Ausbau vereinfachen: Schnellerer Glasfaser- und Mobilfunk-Ausbau braucht einfachere, standardisierte Antrags- und Genehmigungsverfahren. Ziel muss u.a. die vollständige Digitalisierung aller wegerechtlichen Genehmigungsprozesse für Fest- und Mobilnetze sein. Zudem sollte das Potenzial alternativer Verlegetechniken deutlich stärker ausgeschöpft werden, um Kostensenkungs- und Beschleunigungspotentiale beim Glasfaserausbau zu heben.
- Innovationsfähigkeit gewährleisten: Die Akzeptanz des Ausbaus von Festnetz und neuen Mobilfunkstandorten in der Bevölkerung muss deutlich verbessert werden. Das ist eine gemeinsame Aufgabe von Politik und Wirtschaft. Zudem braucht es einen Rechtsrahmen und eine entsprechende Anwendungspraxis, die es ermöglichen, die differenzierten Anforderungen von Wirtschaft und Nutzern an sichere Netze und Konnektivität zu erfüllen. Vor dem Hintergrund von 5G bedeutet dies, dass insbesondere mittels Network Slicing erbrachte Dienste nicht von vornherein durch eine restriktive Regulierung behindert werden dürfen, sondern durch einen Light Touch Approach die Chance erhalten, sich nachfragegerecht zu entwickeln.
Handlungsempfehlungen
- Digitale Technologien anerkennen: Digitale Technologien müssen als wirksame Instrumente für mehr Nachhaltigkeit anerkannt werden: zur Senkung von CO2-Emissionen, zur Beschleunigung der Energiewende, für eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft, aber auch für anhaltendes Wirtschaftswachstum. Regulatorisch müssen daher in allen Politikfeldern die Voraussetzungen geschaffen werden, dass solche Technologien mit Erreichung der Marktreife schnell etabliert und skaliert werden können.
- Für (fast) jedes Problem gibt’s eine digitale Lösung: Digitalpolitik ist nachhaltige Industriepolitik. Für viele aktuell diskutierte Probleme existieren bereits digitale Lösungen – oder sie sind in Reichweite, z.B. in der Mobilität, in der Landwirtschaft oder bei der Energiewende. Es ist politisch erstrebenswert, solche Technologien schnell in die Fläche zu bringen, statt bestehende Strukturen zu konservieren. Für Subventionen, wie zum Beispiel im Agrarbereich, sollte deshalb festgeschrieben werden, dass jeder zweite Euro in digitale Lösungen fließen muss.
- Europäische Strategie schaffen: Die diesjährige deutsche EU-Ratspräsidentschaft sollte von der Bundesregierung zur Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Strategie für mehr Nachhaltigkeit durch Digitalisierung genutzt werden.
- Nachhaltigkeitsstrategie und Digitalpolitik verknüpfen: Bei der Aktualisierung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie sollten die Auswirkungen der digitalen Technologien berücksichtigt werden. Es braucht eine echte Verknüpfung von Nachhaltigkeit mit den Potenzialen der Digitalisierung.
- Nachhaltigkeit in der Infrastrukturförderung berücksichtigen: Technologien wie z.B. Smart Mobility (effizientere Verkehrssteuerung durch Leitsysteme, Autonomes und vernetztes Fahren etc.) oder Smart Grids (Verbesserung der Netzeffizienz, Integration von Erneuerbaren Energien etc.) sind wichtige Bausteine für eine nachhaltige Infrastruktur. Diese Technologien sollten dementsprechend stärker gefördert werden.
Handlungsempfehlungen
- Elektronische Patientenakten zur Behandlungsplattform ausbauen: Die elektronische Patientenakte sollte als Behandlungsplattform, die Zugang zu einem Ökosystem aus Akten und digitalen Gesundheitsanwendungen bietet, ausgebaut werden. Dabei müssen Sicherheit, Standardkonformität, die Nutzung offener Schnittstellen und damit die Möglichkeit zum Austausch von Daten berücksichtigt werden.
- Einheitliche Rahmenbedingungen für Gesundheitsdatennutzung schaffen: Um die sichere Nutzung von (Versorgungs-)Daten zu gewährleisten und auszubauen, müssen schnell einheitliche und rechtssichere Rahmenbedingungen geschaffen werden.
- Klarere Regeln und mehr Mittel für Digitalisierung bereitstellen: Die Investitionskraft von Leistungserbringern sollte durch klarere Regelungen und das Bereitstellen ausreichender, zweckgebundener Mittel verbessert werden, um flächendeckend die Digitalisierung voranzutreiben und Potenziale in der Versorgung zu heben.
- Digitale Gesundheitsinnovationen in die Versorgung bringen: Marktzugang und Erstattung müssen an die Dynamik und die Charakteristika digitaler Gesundheitsanwendungen angepasst werden. Digitale Gesundheitsangebote müssen ein fester Bestandteil der Regelversorgung werden, wenn sie ihren Nutzen unter Beweis stellen.
- Digitalen Arztbesuch mit der Versorgung vor Ort gleichstellen: Ärzte und Patienten sollten individuell entscheiden können, ob die Versorgung digital oder vor Ort in der Praxis stattfindet. Dafür braucht es durchgängig digitale Prozesse und die konsequente Vernetzung aller Akteure über unsere sichere, gemeinsame Gesundheitsinfrastruktur.