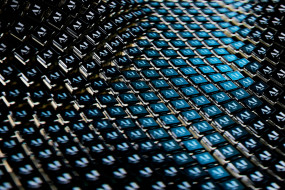Gründen mit Haltung: Wie Frauen in Ostdeutschland das Startup-Ökosystem prägen
Mit dem Report „Startup.Gründerin.Ostdeutsch.“ rückt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) im Rahmen der Digital Hub Initiative die Perspektiven von Startup-Gründerinnen in Ostdeutschland in den Mittelpunkt. Der Bericht beleuchtet deren Beweggründe, Potenziale sowie die spezifischen Rahmenbedingungen und Herausforderungen, mit denen Gründerinnen in der Region konfrontiert sind.
Im Interview sprechen die Autorin und Autor des Reports, Johanna Simon-Lehmstedt und Guido Zinke vom Institut für Innovation und Technik, über Standortbewusstsein, Zebra-Startups – und darüber, warum es neue Impulse braucht, damit das wirtschaftliche Potenzial ostdeutscher Gründerinnen endlich ausgeschöpft werden kann.

Gründen mit Haltung: Was bedeutet Standortbewusstsein für Gründerinnen im Osten?
Viele ostdeutsche Gründerinnen entscheiden sich bewusst für ihren Standort – trotz bekannter Herausforderungen. Wie erklären Sie sich diese bewusste Entscheidung? Und was verrät das über Gründung abseits großer Startup-Hubs?
Johanna: Wir konnten in unserer Befragung eine sehr klare Verbundenheit der Gründerinnen zu ihren ostdeutschen Standorten einfangen – wegen vor allem der sehr guten Ökosystembedingungen, aber auch trotz der klaren Nachteile von fehlenden Unternehmen bis zu hin politisch schwierigen Entwicklungen. Wir lesen das als sehr bewusste Standortentscheidung für einen ostdeutschen Standort heraus, verbunden mit der bewussten Haltung diese Regionen durch ihr Startup zu stärken, das Innovationspotenzial hier zu behalten und in die Innovationskraft und das wirtschaftliche Potenzial zu investieren und dazu beizutragen. Hier sehen viele Gründerinnen in Ostdeutschland einen großen Treiber und Sinnhaftigkeit ihres Unternehmensaufbaus. Aber natürlich steht die Standortentscheidung – wie auch andernorts – im Zusammenhang mit dem jeweiligen Wohn, vor allem Ausbildungs- Studiums- bzw. letzten Arbeitsort.
Guido: Und klar ist auch, dass die Ökosystembedingungen im Osten, gerade in frühen Phasen hoch attraktiv sind: gute Förderbedingungen, hoher Besatz mit wissenschaftlichen Einrichtungen als Ausbildungs- und Ausgründungsorte sowie spätere Partner, gute Infrastrukturen und die Städte sind attraktiv und vergleichsweise günstig. Hinzu kommt natürlich der Hyper-Hub Berlin, der für den Osten nochmal um einiges relevanter ist als ohnehin für Deutschland oder Europa. Und Hubs gleicher Art, aber natürlich geringerer Wirkungen sind auch Leipzig, Jena oder Dresden. Es ist großartig zu lesen, dass die Zahl der Startup-Gründungen in ländlichen Regionen deutlich steigen. Aber in der Regel ballen diese sich dann doch um die Großstädte. Das ist auch gut so und zeigt, dass die Städte und auch die dortigen Universitäten sowie wissenschaftlichen Einrichtungen ihre Funktion als regionale (!) Wachstumstreiber erfüllen können.
Zebra statt Unicorn – eine Frage der Mentalität?
Viele Gründerinnen im Report orientieren sich eher an nachhaltigem Wachstum als an klassischen Skalierungszielen. Ist das ein bewusster Gegenentwurf zum Unicorn-Narrativ – oder eine Reaktion auf reale Markt- und Förderbedingungen?
Johanna: Die Ausrichtung auf stabile, nachhaltige Geschäftsmodelle ist häufig beides: Eine Reaktion auf erschwerte Finanzierungsbedingungen und gleichzeitig ein bewusst gewählter Weg. Startups von Gründerinnen in Ostdeutschland wachsen oft organisch, weil sie seltener Zugang zu Wagniskapital haben und sich stattdessen bootstrappen. Das schafft Unabhängigkeit – aber auch langsameres Wachstum. Diese pragmatische Haltung ist Ausdruck einer tiefen Überzeugung: Das eigene Unternehmen soll langfristig bestehen und regional wirken, nicht nur kurzfristig skalieren. Das Unicorn-Narrativ wird dabei nicht grundsätzlich abgelehnt – aber ergänzt durch alternative Gründungswege. Es gibt nicht nur die eine goldene Lösung, sondern verschiedene Möglichkeiten erfolgreich zu gründen.
Guido: Dass im Startup-Zoo neben Zebras auch einige schnellere Kühe, noch schnellere Pferde und sehr viel schnellere Gazellen – oder meinetwegen Unicorns – stehen, ist ja die Regel und auch gut so. Wir brauchen diese Vielfalt zwischen dem Hyper-Growth von Umsatz, Beschäftigung und Investition und dem langsameren, aber auch beständigeren, nachhaltigeren Wachsen. Darin steckt auch etwas mehr German Mittelstand und weniger Silicon Valley. Entscheidender ist, inwieweit diese typisierten Unternehmensausrichtungen individuell zum potentiellen Wert des Innovationswissen passen, der über das Startup generiert werden könnte. Das hängt sehr davon ab, ob Gründerinnen als auch Finanzier:innen selbst erkennen und – auch über die Rahmenbedingungen - in der Lage sind, dies zu erkennen, das Unternehmen entsprechend auszurichten und zu finanzieren. Ein Problem wird es, wenn Wertpotenzial ungenutzt bleibt, weil vorhandenes Innovationswissen nicht angemessen verwertet werden kann, da kein Kapital zum Springen anliegt. Man also eher Gazelle statt Zebra sein sollte.
Strukturen sichtbar machen: Warum Netzwerke fehlen – und wie wir sie schaffen
Mentoring, Kapitalzugang, bundesweite Sichtbarkeit – diese Themen ziehen sich wie ein roter Faden durch den Report. Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Hebel, um nachhaltige Netzwerke für Gründerinnen in Ostdeutschland zu schaffen?
Johanna: Ein wesentliches Defizit ist der Mangel an strukturell verankerten Netzwerken – sowohl auf Hochschul- als auch auf Unternehmensseite. Es fehlt an Alumni-Strukturen wie etwa an der WHU, wo sich Gründende gegenseitig finanzieren und fördern. Gründerinnen in Ostdeutschland berichten, dass sie sich zwar als Teil einer „Community“ fühlen – aber diese öffnet ihnen nicht automatisch Türen zu Kapital, Branchenkontakten oder Sichtbarkeit. Es braucht gezielte Investitionen in strukturelle Netzwerke, mehr Role Models, bessere mediale Sichtbarkeit und eine stärkere Verknüpfung von Hochschulen mit der regionalen Wirtschaft. Auch Mentoring-Angebote speziell für Gründerinnen können helfen, dieses Vakuum zu füllen.
Prinzipiell wirken Frauennetzwerke und auch die Netzwerke innerhalb der Startup-Communities schon sehr gut und hier besteht ein guter und offener Austausch. Aber gerade wenn es über den Tellerrand hinausgeht und Kund:innen, Branchenkontakte und Kontakte zu Investor:innen gebraucht werden, braucht es warme Intros und „Türöffner:innen“.
Wirtschaftspolitisches Potenzial – gesellschaftlich ungenutzt
Der Frauenanteil unter Gründerinnen liegt in Ostdeutschland bei rund 17 %. Warum gelingt es nicht, dieses Potenzial besser zu heben? Was müssten Politik, Wirtschaft und Gesellschaft konkret ändern?
Guido: Jede zweite Person in Deutschland ist eine Frau, und Frauen in diesem Land sind im Schnitt deutlich besser ausgebildet und qualifiziert. 17, 18 oder auch 19 % Gründerinnen-Anteile sind durch die Bank einfach zu wenig. Hinzu kommen ja noch andere Personengruppen, insb. Menschen mit Migrationshintergrund, die unterproportional im Startup-Ökosystem vertreten sind. Vor allen Dingen liegt das an fehlender Chancengleichheit - die uns am Ende richtig viel Geld kostet, wenn derart Qualifikations- und Innovations-, damit letztlich Gründungs- und Wachstumspotenziale nicht genutzt werden. Das sollte den Handlungsdruck mehr als genug erzeugen.
Johanna: Der Anteil an Gründerinnen bleibt niedrig, obwohl Frauen in Ostdeutschland überdurchschnittlich gut qualifiziert sind. Ursachen sind vielfältig: geringeres Haushaltsvermögen, weniger unternehmerische Vorbilder im Umfeld, strukturelle Unsichtbarkeit weiblicher Gründungsleistungen – und eingeschränkte Kapitalzugänge. Die Zahlen sprechen für sich: Während männliche Teams 834 Mio. Euro Kapital erhielten, waren es bei rein weiblichen Teams nur 43 Mio. Euro. Auch beim Thema Förderlandschaft fehlt es an gezielten Anreizen. Die Lösung liegt in einer dreifachen Strategie: Investitionsanreize für strukturschwache Regionen und diverse Teams, eine stärkere Sichtbarkeit von Gründerinnen – und die Vermittlung von Gründung als legitimer Karriereweg bereits in Schule und Studium. Das Potenzial ist da – wir müssen es endlich sichtbar und wirksam machen.
Die Digital Hub Initiative des BMWE vernetzt mittelständische Unternehmen und Corporates mit Innovationspartnern aus der Startup-Szene und der Wissenschaft. Mit über 25 Hubs fördert sie den Austausch von Technologie- und Wirtschaftsexpertise und stärkt so die Innovationskraft des Standorts Deutschland.
Vorgestellt wurde der Report am 20. Mai 2025 im Rahmen des Ostdeutschen Wirtschaftsforums (OWF) in Bad Saarow und anschließend bundesweit veröffentlicht. Das OWF stellte in diesem Jahr Startups besonders in den Fokus und würdigte ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Dynamik und zur Zukunftsfähigkeit Ostdeutschlands.